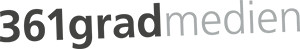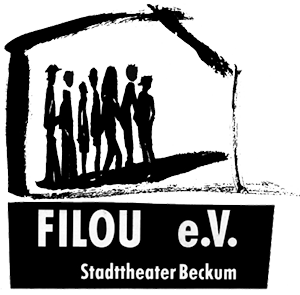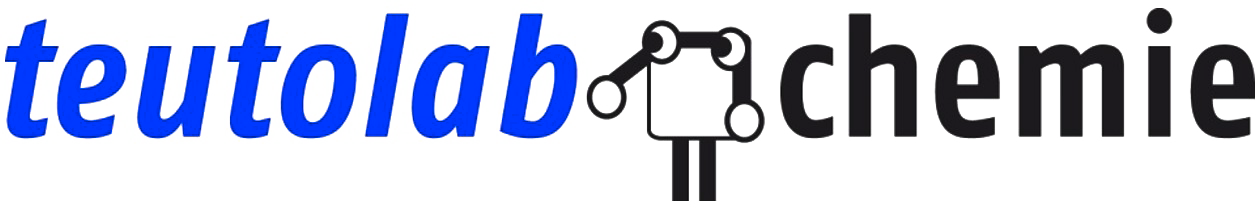Portrait
Das Albertus-Magnus-Gymnasium ist die größte und mit einer über hundertjähringen Tradition auch die älteste Schule Beckums. Seit Jahrzehnten wird bei uns besonderer Wert auf den humanen Umgang miteinander, ein gutes Lernklima und auf das soziale Lernen gelegt. Davon profitieren auch die Lernerträge, wie die landesweit durchgeführten Erhebungen immer wieder aufs neue belegen.
Das Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum wird zur Zeit von 811 Schülerinnen und Schülern besucht. Diese werden von 70 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Der Unterricht am AMG ist in Doppelstunden als kurzer Ganztag bis 15 Uhr mit einer einstündigen Mittagspause organisiert. In der Mittagspause gibt es ein vielfältiges Freizeitangebot sowie ein gesundes Mittagessen.
Das AMG verfügt über drei Unterrichtsgebäude, die auf einem großzügigen, intensiv begrünten Schulgelände liegen. In dem Hauptgebäude von 1968 befinden sich die zum großen Teil hervorragend ausgestatteten naturwissenschaftlichen Fachräume sowie die Fachräume für Kunst und Musik, die Mensa sowie ein von Schülerinnen und Schülern gestalteter Kiosk. Das denkmalgeschützte, frisch renovierte Prudentiagebäude beheimatet heute vor allem die Oberstufe, während in dem Erweiterungsgebäude von 1978 die Mittelstufe unterrichtet wird. Für das Fach Sport stehen zwei eigene große Hallen zur Verfügung. Zahlreiche weitere Sportstätten liegen in direkter Nachbarschaft unserer Schule, so das Beckumer Freibad, das Hallenbad und das Jahnstadion.
Mit fast 1000 Menschen ist das Albertus-Magnus-Gymnasium ein noch gut überschaubares Gesamtsystem. Andererseits ermöglicht die Größe unserer Schule ein sehr vielfältiges Fächerangebot. Alle Naturwissenschaften und fast alle Gesellschaftswissenschaften werden als Leistungsfächer angeboten. In der Klasse 7 können die Schülerinnen und Schüler Französisch, Latein oder Spanisch als zweite Fremdsprache nach Englisch wählen. Im musischen Bereich gibt es eine beeindruckende Vielfalt von Orchestern und Chören. Kulturinteressierte Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus an der Theaterwerkstatt oder einem Videoprojekt mitwirken.
Am Albertus-Magnus-Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler individuell und ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend gefördert. So unterstützen wir die Teilnahme an der digitalen Drehtür sowie an Schülerwettbewerben in den Sprachen, in Mathematik und in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften. In Englisch, Französisch und Spanisch können hochwertige Sprachzertifikate erworben werden, mit denen ein Studium im Ausland problemlos möglich ist. Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, erhalten bei uns gezielte Unterstützung.
Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler darin, in unserer Gesellschaft erwachsen zu werden und darin ihren Platz zu finden. Sie sollen sich einerseits hohes fachliches Wissen und Können erarbeiten, andererseits aber auch in der Lage sein, ihre privaten und beruflichen sozialen Beziehungen produktiv zu gestalten und am politischen Leben teilzunehmen. So üben wir in der Schule auch bewusst Tugenden ein und setzen uns mit Normen und Werten auseinander.
Wir reflektieren mit unseren Schülerinnen und Schülern unser Leben in einer globalisierten Welt mit vielfältigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen. Wir möchten die Schüler dazu anregen, verantwortlich zu handeln, anderen Kulturen respektvoll zu begegnen und eine solidarische Grundhaltung gegenüber den Menschen in allen Ländern zu entwickeln.